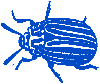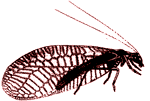
Oder:
Science-Fiction sind ein Lieblingskind der Linken. Während in den 80er Jahren in den Kinosälen, in denen Rambo über die Leinwand flimmerte, Buttersäure vergossen wurde, treffen wir nur selten GenossInnen, die weder Star Wars noch Alien gesehen haben. Auch heute noch entspannen wir gerne nach einem anstrengenden Tag bei einem guten Kinofilm und begegnen den Seltsamkeiten des Kosmos.
Say Cpt., say what
Science Fiction (SF) hat im Film eine lange Tradition. Bereits in der Stummfilmzeit gibt es SF im Kino. 1902 dreht Georges Mélliès "Le Voyage dans la Lune" frei nach Romanvorlagen von Jules Verne und H.G. Wells. Mit diesem ca. 20-minütigen Film gewinnt Mélliès internationalen Ruhm und wird zum eigentlichen Begründer des SF-Films. Fast alle gängigen Motive, die des Genre in der Zukunft prägen sollen, sind schon in den Filmen der Frühphase vertreten.
Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre treten die sogenannten Superhelden-Serials an die Seite der SF-Filme. Sie sind geprägt von US-amerikanischen Idealen und patriotischem Gedankengut. Beispiele sind Flash Gordon oder Buck Rogers. Diese Serien entstehen vor dem Hintergrund einer angespannten internationalen Situation, deren Höhepunkt der Zweite Weltkrieg ist.
Es ist eine Zeit der Konkurrenz und Auseinandersetzung, keinesfalls eine Zeit der friedlichen Koexistenz und Kooperation. Das spiegelt sich auch in den Figuren der Superhelden: Die in der Krisenzeit produzierten Heldenbilder vermitteln Nationalgefühl und Selbstbewußtsein. Militärisch kämpferisch stehen die Figuren ihren Mann und dienen als Modelle für die Soldaten, die in den Krieg ziehen (müssen). Die feindlichen Figuren sind während des Zweiten Weltkriegs überwiegend Deutsche oder Japaner. Bis zum Ausbruch des Kriegs und der eindeutigen Frontstellung schwanken die Feindbilder je nach politischer Großwetterlage. Die Superhelden werden zu Weltpolizisten, von keiner Behörde und keinem Parlament legitimiert oder kontrolliert. Überall, wo Not am Mann ist, retten, löschen, bergen und befreien sie. Analogien zur Großmachtpolitik der USA, die sich aus angeblichen Sicherheitsinteressen oder ethisch-moralischen Leitsätzen heraus in die Angelegenheiten fremder Nationen einmischen, sind offensichtlich.
Anfang der 60er eröffnet der Präsident der USA, John F. Kennedy, das Rennen um den Mann auf dem Mond. In einer Rede erklärt er 1961 eine Reise zum Erdtrabanten zum vorrangigen Ziel der US-amerikanischen Raumfahrt. Unmittelbar vorausgegangen ist der erste Weltraumflug eines Menschen überhaupt: Der Sowjet-Bürger Jurij Aleksejewitsch Gagarin umkreist die Erde. Die Konkurrenz der beiden Gesellschaftssysteme Kapitalismus und Kommunismus wird nun endgültig auch ins All getragen. Dem SF-Film fällt eine neue Aufgabe zu. Die Eroberung des Weltraums soll nicht nur vorstellbar sein, sie muß zudem auch noch sinnvoll erscheinen. Die gigantischen Kosten, die das Vordringen in den Kosmos verursacht, sind nicht alleine zu rechtfertigen mit einem Wettlauf um Prestige und Erfolg, den zwei Supermächte untereinander austragen. Auch Rückschläge müssen ihren Platz zugewiesen bekommen als bedauerliche, aber unvermeidliche Opfer auf einem richtigen Weg. So wirkt es sich beispielsweise sehr negativ auf das Image der Weltraumfahrt aus, als 1967 drei US-amerikanische Astronauten bei einem Feuer in einer Rakete verbrennen.
Ende der Sechziger ändert sich die SF entsprechend dieser neuen Vorgaben, aber auch entsprechend der gesellschaftlichen Veränderungen, die stattfinden. Einen Wendepunkt stellt der 1968 unter der Regie von Stanley Kubrick gedrehte Film "2001: Odyssee im Weltraum" dar. Nachdem Kubrick mit dem Film "Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu lieben" einen beachtlichen Erfolg gelandet hat, stellt ihm die Produktionsfirma MGM sowohl viel Geld als auch eine Menge Zeit zur Verfügung, um einen weiteren Film zu machen. Nach einer Vorlage von Arthur C. Clarke und in einer Produktionszeit von vier Jahren entsteht 2001. Der Film ist keineswegs vom ersten Tag an ein Kassenknaller. Sein Bekanntheitsgrad nimmt langsam, aber stetig zu. Intellektuelle fühlen sich angesprochen, heftige Debatten über die Interpretation des Films (vor allem der Schlussszene) entbrennen. 2001 wird berühmt und verhilft der SF zu ihrem Durchbruch aus der Schmuddelecke der B-, C- und D-Movies in das Rampenlicht der großen Kassenschlager.
In der Folgezeit entstehen eine Reihe fortschrittlicher SF-Filme, bei denen Fragen nach der Entwicklungsrichtung von Gesellschaft im Vordergrund stehen und kritisch beleuchtet werden (z.B. "Planet der Affen", "Uhrwerk Orange" oder "Jahr 2022 ... die überleben wollen"). In diesen Filmen findet sich der Aufbruchsgeist der späten sechziger, frühen siebziger Jahre, als es galt, dem Mief der Nachkriegszeit den Garaus zu machen. Aus heutiger Sicht enthalten viele dieser Machwerke Momente, die durchaus einer Hinterfragung bedürfen. Viele von ihnen erscheinen unerträglich sexistisch, ein Eindruck, der nicht zuletzt dank der Segnungen der ach-so-freien Liebe verstärkt hervortritt.
Mit der Sinnhaftigkeit der Weltraumeroberung ist es jedoch nicht weit her. Auch Propaganda, die das Vordringen in die unbekannten Weiten als dem menschlichen Erkenntnisinteresse entspringend und der gesamten Menschheit zur Freude und zum Nutzen darstellen will, kann daran nichts ändern. 1969 wird das Rennen der Supermächte entschieden: Neil Aiden Armstrong betritt als erster Mensch den Mond und läutet damit den Niedergang der Raumfahrt ein, der die siebziger und achtziger Jahre kennzeichnet. Das Ziel ist erreicht und der Sinn der Raumfahrt wird nun immer kritischer hinterfragt. Andere Planeten sind in unerreichbarer Ferne, und das neue Konzept des
Space Shuttle, das die gute, alte Rakete ablöst, macht keine positiven Schlagzeilen. Die Explosion der Raumfähre Challenger nur eine Minute nach ihrem Start im Jahr 1986 markiert den Tiefpunkt des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms. In Frage gestellt wird auch der Charakter der NASA-Aktivitäten. Schließlich kommt nur ein Drittel der Erkenntnisse aus der Raumfahrt zivilen Zwecken zugute. Der überwiegende Teil dient der militärischen Entwicklung.
Von diesen Widrigkeiten der realen Raumfahrtwelt bleibt der SF-Film jedoch unberührt. Ganz im Gegenteil: Seine große Stunde schlägt. In den Siebzigern beginnt die Filmindustrie, sich vom "Fernseh-Schock" zu erholen. Der Trend geht hin zu großen, aufwendig gemachten Filmen, die ihre volle Wirkung nur im Kino entfalten und das Publikum anziehen. Die ganze Familie soll nach Möglichkeit mit ein und demselben Kinofilm unterhalten werden. Nachdem Kubrick gezeigt hat, das mit SF durchaus Geld zu verdienen ist, wird dieses Genre als Stoff für Mammut-Verfilmungen entdeckt. "Star Wars" (1976, Regie George Lucas) und "E.T." (1981, Regie Steven Spielberg) sind Meilensteine. Beide Filme erlangen Kultstatus und spielen Gewinne ein, von denen zwei Jahrzehnte zuvor niemand zu träumen gewagt hätte.
Die Produktion von Kinofilmen wird zunehmend zu einem wirtschaftlichen Unternehmen. Nicht umsonst ist die Rede von der Filmindustrie. Der Erfolg oder Mißerfolg eines Films ist der Erfolg oder Mißerfolg einer wirtschaftlichen Investition in Millionenhöhe. Um den Erfolg sicherzustellen, werden Filme zunehmend von Werbefeldzügen und Merchandising begleitet. Die Tendenz geht dahin, daß die reinen Produktionskosten hinter die Kosten für das Marketing zurückfallen. So war bei dem Film "Godzilla" die Summe, die für Vermarktung veranschlagt wurde, etwa doppelt so hoch wie die reinen Produktionskosten.
In den neunziger Jahren überschwemmt eine Flut von SF-Filmen den Kinomarkt. Bemerkenswert ist das Wiederaufleben der fünfziger-Jahre-SF. Remakes von billigen B-Filmen aus den Fünfzigern erreichen die Zuschauerin in der Glitzer-Glamour-Packung mit noch mehr Action. Der SF-Film ganz allgemein und das Außerirdische im besonderen boomen. Der Blick des Publikums wird auf das Fremde gelenkt, das andere, das außerhalb liegende.
Das Terrain ist abgesteckt
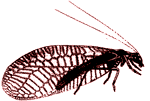
Feindbilder tragen oft archetypisch-mythologische Züge. Gezeigt werden Untiere oder Bestien, die zerstören und vernichten. Gleichzeitig werden dem Feind Attribute der Minderwertigkeit, des Niedrigen, des Unmenschlichen zugeordnet. Besonders Feindbilder westlicher Gesellschaften betonen am Feind das Merkmal der Unmenschlichkeit, der Mißachtung des menschlichen Lebens. Der/ie Gegner/in wird deindiviualisiert, abgewertet und damit wird die Verteidigung gegen den/die Feind/in legitimiert.
Die Konstruktion des "Fremden" und des "Eigenen" ist keine Erfindung der Neuzeit (oder gar der SF), sondern eine ziemlich alte Sache. So finden wir in der europäischen Geschichte bestimmte Grundmuster in der Darstellung des Fremden, die durchgängig sind. Das Fremde ist meist barbarisch, degeneriert, tyrannisch oder sexbesessen.
In frühen Reiseberichten oder Weltchroniken finden sich Beschreibungen von Phantasiebewohnerlnnen, die als kopflos oder hundsköpfig, einfüßig, zwitterartig oder als Monstermenschen dargestellt werden. Im Jahre 1356 berichtet der englische Ritter John Mandeville von merkwürdigen Wesen einer Insel Andaman gleich neben dem Land-wo-der-Pfeffer-wächst, die ihre unheilbar Kranken aufessen. Die Bewohner der Nachbarinsel erscheinen wohl ebenfalls nicht besonders sympathisch: "Auf einer anderen Insel im Süden wohnen schlimme und schmutzige Menschen, die bösartig sind. Sie besitzen keinen Kopf, sondern ihre Augen stehen in der Achselhöhle. Ihr Mund befindet sich mitten vor dem Herzen, krumm wie ein Hufeisen."
Als Europa 1492 in der Fortsetzung der Reconquista das entdeckt, was es die "neue Welt" nennt, spiegeln diese Darstellungsformen in zunehmendem Maße neue Zielsetzungen wieder. So weiß auch Christoph Kolumbus, als er im Jahre 1493 von seiner Entdeckungsreise heimkehrt, von fremden Völkern aus dem Land "Caniba" zu berichten, die nur ein Auge mitten in der Stirn haben. Die spanische Propaganda rechtfertigt in den darauffolgenden Jahren ihre Ausrottungsfeldzüge gegen die indigene Bevölkerung Amerikas mit der Begründung, die scheinbar bekehrungsunwilligen Kannibalen ließen nicht von ihrem gefräßigen Barbarentum ab.
Berichte aus Afrika betonen oft genau jene Aspekte afrikanischen Lebens, die im Westen als äußerst abstoßend gelten, um somit Anzeichen für eine allen gemeinsame Menschlichkeit zu unterschlagen. In der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts wimmelt es regelrecht von dümmlichen, blutrünstigen und faulen Negerinnen. Ebenso gibt es Spekulationen über den Ursprung und die Ähnlichkeit zwischen Afrikanerlnnen und Affen. Einerseits gelten afrikanische Menschen als faul, abergläubisch, wild und feige, andererseits als höflich, edel und voller Achtung älteren Personen gegenüber, aber immer den europäischen Menschen unterlegen.
"Außerirdische", wie sie im Science Fiction charakterisiert werden, lassen sich problemlos in die Reihe derer setzen, denen Unmenschlichkeit oder zumindest Minderwertigkeit unterstellt werden. Treten sie als Feind auf, so sind sie blutrünstig, imperialistisch und unberechenbar; zwar oft hoch intelligent, aber mit keinerlei menschlicher Gefühlsregungen, geschweige denn Eigenverantwortung und Eigeninitiative versehen. Nicht selten stellen sie eine eigentümlich anonyme Masse dar, können nicht denken und führen Befehle aus, die ihnen ein höheres Wesen erteilt. Ihre Technologie ist zwar hochentwickelt (und oft höher entwickelt, als die der "Menschheit"), ihr Verhalten jedoch eher primitiv.
Aber auch wenn Außerirdische in friedfertiger Absicht, als Freund der Menschheit auftauchen, fehlen ihnen doch ein paar wichtige Eigenschaften, die das "Menschsein" ausmachen: So kann doch selbst Spock, der überintelligente Vulkanier und enge Vertraute von Captain Kirk, nie ein richtiger Mensch sein, da ihm dafür wichtige Attribute, wie Gefühle, fehlen. Auch E.T. ähnelt einem Reptil, und mit hoher Stirn und großen Augen erweckt er eher den Anschein eines Neugeborenen als eines ausgewachsenen Lebewesen. Oft sind Außerirdische nur schlechte Kopien des Menschen, oder wie z.B. in "Krieg der Sterne" eine merkwürdige Mischung zwischen Tier und Menschen (z.B. Chewbacca).
"Aliens" gehören somit zu den Wesen, vor denen sich der US-amerikanische oder europäische Mensch schützen muß, zumindest abgrenzen und sich ihm überlegen fühlen kann. Aufgrund dessen, daß Aliens eine "imaginäre Bedrohung" darstellen, d.h. nicht real existent sind, sind sie als stellvertetende Gruppe auswechselbar, d.h. die Eigenschaften können auf jeweils anvisierte Gruppierungen übertragen werden. Sei dies nun eine "illegale Immigrantln" oder der
"irre Saddam". Das bleibt der Zuschauerin ganz individuell überlassen. Dabei muß klargestellt werden, daß dem SF (wie auch anderen Genres, z.B. Horror, etc.) hierbei nur eine ganz allgemeine Bedeutung zufällt, die unspezifisch für emotionale Aufrüstung sorgt.
Go ahead with the rast

Die Betrachtung eines Kinohits Marke Hollywood verrät viel über den Mainstream, das was gefällt und was viele sehen wollen (schließlich sollen die großen Produktionen Gewinne einspielen). Es gelingt den Filmen oft treffend, den Zeitgeist einzufangen, zu bebildern und gleichzeitig zu verstärken. Sie wirken als Katalysatoren, Trendsetter. Cooles Aussehen bekommt einen Namen. Coole Typen mit ebensolchem Verhalten werden endlich eindeutig als solche identifizierbar.
Die vermehrte Produktion von SF-Filmen in den Neunzigern wirft Fragen hinsichtlich des gesellschaftlichen Kontextes auf. Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks fällt ab 1989 für die westlichen Gesellschaften der äußere Feind weg, und damit auf einmal auch die Legitimation für einen Großteil der innergesellschaftlichen Repressions- und Kontrollmechanismen. Eine Selbstdefinition, die mehr als alles andere die Abgrenzung von einem ANDEREN Gesellschaftssystem war, gerät ins Wanken. Wer sind wir? Wie soll sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln? Welche Werte haben wir? Diese und ähnliche Fragen müssen auf einmal neu beantwortet werden, nicht mehr aus der Abgrenzung von einem Ostblock heraus.
So erklärt der US-amerikanische Präsident nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der neue Feind sei nun die Unsicherheit, die Unvorhersehbarkeit und die Instabilität. Gefahren, die die westlichen Nationen fürchten, konzentrieren sich fortan auf den Nahen Osten und allgemein auf den Trikont. Die wachsende Armut (und nicht nur die im Trikont) stellt einen neuen Unsicherheitsfaktor dar. Schließlich könnte mit einer Revolution (wie in Russland, China oder Kuba) jederzeit eine neue Gegenmacht entstehen. Wenn der Feind nicht mehr "außen" ist (SU), sondern innen, schlägt sich dies auch konkret im SF nieder. SF und der Boom dieses Genres weisen Parallelen auf zu anderen Diskussionen, die zur Zeit in der Gesellschaft laufen, so z.B. innere Sicherheit. So werden neue Tugenden, wie z.B. Wachsamkeit suggeriert. ("Du mußt auf der Hut sein, es ist besser sich an die Polizei zu wenden, falls etwas Unvorhergesehenes auftritt"). Durch imaginäre Bedrohungsszenarien werden Ausgrenzung und Militarisierung in der Gesellschaft legitimiert. SF-Film beeinflusst diese Diskussion weitgehend unbemerkt, bzw. ist Ausdruck einer veränderten Geisteshaltung, die diese Diskussion überhaupt erst möglich macht.
"Men in Black", 1997: Das Fremde ist etwas Fremdes, das als solches registriert und kontrolliert werden muß - mit allen Fehlern, die ein solches System hat. Das Fremde ist glibbelig und seltsam, aber darin nicht erstaunlich oder ungewöhnlich. So hält der neue Weltraumsuperbulle ohne Erstaunen oder Ekel ein außerirdisches Tintenfischbaby auf dem Arm, bei dessen Entbindung (? ab dieser Begriff wohl zutreffend ist) er geholfen hat. 'Das Fremde ist gut und böse, sympathisch und unsympathisch. Die Menschen sind gut und manchmal blöd. Immigrationspolitik - Anspielungen: Liberale Position, regulierter Einwanderung wird das Wort geredet.
Dies wirft natürlich die altbekannte Frage nach der Henne und dem Ei auf. Wer bestimmt letztendlich, was gedreht wird? Ist das alles eine grof3e Planung oder doch eher ein Ineinandergreifen verschiedener Mechanismen, sowohl politischer als auch wirtschaftlicher Natur'? Der größte Teil der Produktionen sind Made in Hollywood - SF Filme sind teuer -, zwar produziert für den Rest der Welt, aber immer mit dem Yankeeeigenen Blick auf die Welt. Es muß unterschieden werden zwischen den wenigen Filmen, die einen Mainstream "erzeugen" können und der großen Zahl derer, die nur mitschwimmen. Da gibt es einerseits die großen Kassenknaller, die mit aufwendigen Werbekampagnen in die Kinos gebracht werden und andererseits eine Anzahl von S- und C-Movies, die sich an diese anschließen. Einige Eigenschaften machen SF als Stoff für Hollywood gerade in den 90ern praktischer denn je. SF kommt keiner PC-Diskussion in die Quere. Bis in die 60er Jahre können Helden wie John Wayne in den gerechten Krieg gegen die wilden Indianer ziehen. Dann kommt die Bürgerrechtsbewegung, und John mul3 sein Kriegsbeil vergraben. Wer könnte sich heute schon vorstellen, daß als Kriegsfilmersatz blutrünstige, indianerkillende Western gedreht würden. Unvorstellbar. Aber Aliens. Aliens haben keine Lobby. So ist es möglich geworden, eine ganze Reihe von Kriegsfilmen zu drehen ohne dafür kritisiert oder angegriffen zu werden. Die Zeit der zumindest vordergründig nachdenklichen Vietnam-Trauma-Verarbeitungsfilme ist vorbei. Jetzt gewinnt die Solidargemeinschaft Erde wieder ordentliche Kriege. Wir müssen nur an den alten Werten festhalten, dann geht das alles schon.
In einer Phase der gesellschaftlichen Destabilisierung und Reorientierung wird auf ein ästhetisierendes Mittel zurückgegriffen, in dem die Definition der Gesellschaft im Kampf gegen einen amorphen Gegenpol stattfindet: Der amorphe Gegenpol ist das ANDERE, das FREMDE, im SF dargestellt durch Monster, Mutationen oder Aliens. Die Eigenschaften, die diesem Fremden zugeschrieben werden, verraten, welche Gefahren wir als gute Erdenbürger zu fürchten und zu bekämpfen haben. Und immer wieder wird uns versichert: Die ANDEREN sind schuld, agressiv wollen sie unser Leben verändern.